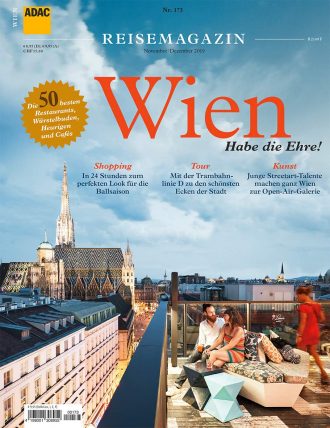Etwa ab 7.30 Uhr am Morgen geht das Spiel los. Der Bus 20 B hält, und die Menschen perlen heraus, bestückt mit riesigen Kühlboxen, aufgeblasenen Einhörnern und üppigen Billataschen. Sie reihen sich geduldig in die Schlange ein, denn noch ist es nicht so weit. Christine, die Dame an der Kassa, nimmt es genau. Eine Minute vor acht? Nein, es gibt Regeln! Auf den Gongschlag ruft sie energisch: „Acht Uhr … bitte!“ Die Eisentore werden geöffnet, die Menschen gehen zügig, aber gelassen hinein. Jetzt geht es schnell, denn wer um diese Zeit schon da ist, der zahlt keinen Eintritt, der hat eine Saisonkarte, die er nur kurz vorzeigt.
Vieles, was hier im Strandbad Gänsehäufel passiert, wirkt unaufgeregt ritualisiert, folgt einem ungeschriebenen Muster. Manche Menschen kommen seit Jahrzehnten, andere arbeiten hier seit einem Vierteljahrhundert. Sie machen alles wie ihre Eltern, die es von ihren Großeltern haben. Veränderungen gibt es woanders. Es ist eine Maschinerie, die seit mehr als einem Jahrhundert so (und nur so) funktioniert. Das sieht man auch an der Architektur: lange, schachtelartige Gebäude, vollkommen schnörkelfrei und total funktional. An den grauen Häuserwänden wird sehr spartanisch Auskunft gegeben: „Liegenaufbewahrung 217–324“ etwa oder „Kästchen M“ sind die einzigen Aufschriften. Aber wer hierherkommt, der weiß, was all die Zahlen sollen. Die Toiletten heißen „Aborte“, die Duschen „Brause“. Die lang gezogenen Gebäude sind parallel und so gleichförmig angeordnet, dass Kampfpiloten sie im Zweiten Weltkrieg für Kasernen hielten, weshalb das Freibad völlig kaputt gebombt wurde. Und genau so wieder aufgebaut.
Das Gänsehäufel ist das größte Schwimmbad Österreichs, eines der größten in Europa obendrein. 28 Hektar groß ist die angeschwemmte Insel in der Alten Donau, die „Haufen“ genannt wurde. Und weil hier früher Gänse gezüchtet wurden, ist der Name schon erklärt. Am 5. August 1907 wurde die bewaldete Sandinsel dann offiziell zur Badeanlage respektive zum „Strandbad der Commune Wien am Gänsehäufel“ und in den 112 Jahren seither längst zur Legende. Über den Sommer kommen rund 600 000 Menschen hierher, an einzelnen heißen Tagen um die 30 000. Auch in Deutschland ist das Bad manchem bekannt durch Rainhard Fendrichs Sommerhit „Strada del Sole“ von 1981, der mit dem Satz endet: „I steh aufs Gänsehäufel, auf Italien pfeif i.“ Ein Satz, der heute noch auf T-Shirts gedruckt wird.
Wer das Gänsehäufel verstehen will, der geht vom Eingang weg schnurgerade zum Weststrand. Nach wenigen Minuten finden sich linker Hand die Strandkabinen, rechts bereits erste Vorbaukabinen, die ein paar Meter weiter hinter den Turmkabinen zu einer regelrechten Siedlung anwachsen. Diese Begriffe benutzt man als gelernter Wiener natürlich nicht. Die Vorbaukabinen (weil sie zu dem kleinen, rechtwinkligen Abstellraum noch eine kleine Terrasse haben) heißen Kabanen, die Strandkabinen nur Kabinen. Außer Kabanen und Kabinen gibt es noch Kasterl (Schließfächer verschiedener Größe), aber die sind wieder ganz woanders.
Die Kabanen sind die heimlichen Paläste des Gänsehäufels. Sie werden saisonweise vermietet und meist vererbt. Die Wartezeit beträgt derzeit sechs Jahre. Hier bauen die Wiener ihre Campingmöbel auf, hängen kitschige Bilder an die Außenwand, decken liebevoll den Tisch, lassen Rosen ranken und Gartenzwerge aus sonnengebleichten Gesichtern ins Leere blicken.
Vor Strandkabine Nr. 111 sitzt Elisabeth Tschapka in einem geblümten Gartenstuhl, ihrem „Sesserl“, und erklärt Nachbarin Irmgard Seifert, wie ihr Smartphone funktioniert. Drüben, im Schatten des Baumes, liegt ihr Mann Wolfgang in seinem Sesserl. An seinem Platz. Alles hat hier seinen Platz. „Es gibt Stammplätze, auf die sich nie ein anderer setzen würde“, erklärt Elisabeth Tschapka und zeigt Richtung Wiese. „Da hinten würde ich nie mein Sesserl aufstellen, weil da kommt der Herr Fritz her.“ Die Tschapkas haben andere Plätze: „Dort drüben, bei den Rosen, dort frühstücken wir.“
Wolfgang Tschapka kam schon als Sechsjähriger mit seinen Eltern hierher. Das war Mitte der 1950er-Jahre. Als Kind ist er hier oft ins Kasperltheater gegangen, das es heute noch gibt. Oder zum Minigolf. Oder er hat Hausaufgaben gemacht unter dem Vordach der Kabine. „Bei Regen“, erinnert er sich, „war es dort am gemütlichsten. Draußen hat’s geplätschert, und ich hab hier im Sessel ein Buch gelesen.“ Sie schätzen, dass sie einen Garten haben, in dem sie nicht arbeiten müssen, die gute Nachbarschaft und „die gute Luft, weil es ja eine Insel ist“.
Mit der Kabine sind sie hochzufrieden, mehr wollen sie nicht. Die Kabane kostet schließlich rund 200 Euro mehr, exakt 627 Euro pro Saison, inklusive drei Saisonkarten. Es gibt nur 290 Kabanen, dafür aber 2165 Saisonkabinen. Und die Kabane böte lediglich den Vorbau und eine Gaskartusche als zusätzlichen Komfort. „Gut, damit können Sie ein Pfandl oder eine Eierspeise machen oder sich Wasser wärmen. Aber mir geht das nicht ab“, sagt Elisabeth Tschapka. Denn wenn sie mal was aufwärmen will, dann hilft eine Nachbarin. Und auch die Besitzer der Kabanen müssen ja, so wie alle anderen, das Bad um acht Uhr abends verlassen.
Die Tschapkas haben ihre Kabine nach innen hin, zum Weg. Ganz anders Familie Joseph, die zum Strand und zum Wasser hin „wohnt“. Heute sind die Zwillingsbrüder Markus und Franz da, Tanten, Mutter und Kusinen mal nicht. Franz Joseph, der tatsächlich so heißt, kommt seit seinem fünften Lebensjahr ins Gänsehäufel, also mithin auch schon mehr als 35 Jahre. „Es ist wie Urlaub auf einer Insel. Einer Insel in Wien.“ Er liebt das System mit den Kabinen, in denen die Josephs ihre Campingmöbel schichten, dazu Badesachen, Tisch und Geschirr. Franz Joseph wohnt im 5. Bezirk, das ist weit weg, aber nach der Arbeit kommt er gern mal her. Weil er dann nicht nachzudenken braucht, ob er Handtuch und Badehose dabeihat, „es ist ja eh alles da“. Auch schön: „Es ist ruhig, und selbst wenn viel los ist, dann ist es immer noch kommod.“ Das schätzt er am Weststrand, den er „Pensionistenstrand“ nennt, im Gegensatz zum Oststrand, für ihn der „Bumbum-Strand“, weil dort die Jungen ihre Ghettoblaster dröhnen lassen. „Es kann hier nicht fad werden, es gibt ja alles“, sagt Franz Joseph. Er meint: Tennis, Tischtennis, Klettergarten, Stand-up-Paddling, Fußball, Basketball, Volleyball.
Am Platz von Maxi Orth blüht eine rote Rose in einer Plastikflasche. Die Schönheit im Gänsehäufel ist pragmatisch. „Die hat es angeschwemmt, schon vor einer Woche“, und Orth hat sie aus dem Wasser gefischt. Was ja auch sein Job ist. Wie der genau heißt, das weiß er gar nicht, „Badewart oder Bademeister“, jedenfalls passt er auf die Badenden am Weststrand auf, was in der bis zu 4,60 Meter tiefen Alten Donau wichtig ist. Gerade wenn Schulklassen da sind, denn „nicht immer überprüfen die Lehrer, ob die Schüler schwimmen können“. Dann kann es schon sein, „dass wir springen müssen“, so heißt das, wenn es rettungshalber ins Wasser geht. Das Spannendste im vergangenen Sommer war, „dass wir mal Ringelnattern und Schildkröten fangen mussten“. Genug Zeit also, den schönsten Sonnenuntergang zu genießen, der so ab sieben, halb acht zu bewundern ist. Sein Geheimtipp. Dann rutscht die Sonne langsam hinter die Gebäude der UNO-City am Ufer gegenüber.
Das lässt sich auch etwas weiter nördlich beobachten, von der Terrasse des Restaurants Weststrand aus. Unter Angestellten und Stammgästen ist es der Geheimtipp, denn Küchenchef Mario Neppl hält nichts von Freibad-Imbissbuden-Mampf. Natürlich gibt’s bei ihm den obligaten Klassiker – Wiener Schnitzel mit Pommes. Aber schon das energische Hämmern aus der Küche verrät, dass hier täglich Fleisch geklopft wird. Auch alles andere wird frisch zubereitet, und Neppl macht sich immer wieder Gedanken um besondere Tagesgerichte: Zander auf cremigen Eierschwammerlnudeln, Wiener Tafelspitz mit Kohlgemüse und Rösti. Für die Rindsuppe rührt er kein Pulver an, sondern kocht die Knochen selbst aus. Seit 25 Jahren ist er jetzt am Weststrand, damals sei das „ein Würstlstand mit Gulaschkanone“ gewesen. „Ich hab lang genug Abenddienste gemacht, I mog nimmer. Hier ist um 20 Uhr Badeschluss, das ist angenehm.“ Dafür nimmt er in Kauf, dass er von den äußeren Umständen abhängig ist, denn es gibt keine Innenplätze, nur die Terrasse. Aber darauf stellt er sich ein: „Der Wetterbericht und ich gehen Hand in Hand“, sagt er. Und wenn Regen angesagt ist, dann kauft er eben weniger oder gar nichts ein. Denn auch im Großmarkt ist er (fast) jeden Tag ab sechs Uhr morgens.
Hinter den Kulissen arbeiten Menschen wie Hannes und Ewald. Die Techniker sind dafür zuständig, dass das Wasser sauber ist. Allein im Wellenbecken sind es eine Million Liter. Lang bevor die Gäste eingelassen werden, müssen sie bereits ihren Hauptjob des Tages erledigt haben – das Rückspülen des Filters. In dem sammelt sich über den Tag alles an, was nicht ins Badewasser gehört: Sonnenmilch, Haare, Feinpartikel, aber auch Laub von den Bäumen und Plastikreste von Wasserbomben. Dabei müssen sich Hannes und Ewald konzentrieren, eine Abfolge von Knöpfen ist zu drücken und zu schieben, und wenn sie sich vertun, läuft der Dreck zurück ins Becken. Das müsste dann für den ganzen Badetag geschlossen werden. Ein Desaster an einem Sonntag bei 32 Grad im Schatten.
Hannes und Ewald sind zwei von 75 Angestellten, über die Markus Petrowicz zu wachen hat. Als Betriebsmeister ist er einerseits der Chef des Gänsehäufel, hat andererseits aber den bedauernswertesten Job im Bad: Er sitzt bei jeder Temperatur in seinem Büro. Er macht dort „alles“, wie er sagt. Im Detail wäre das: „Dienstpläne schreiben, Leute einteilen, Bestellungen abgeben, Streit schlichten.“ Und versuchen, das an heißen Tagen krasse Verhältnis von maximal 75 Angestellten zu bis zu 30 000 Badegästen zu moderieren. „Mein Vorgänger hat gekündigt, dem war’s zu viel“, sagt er. „Mir nicht, ich belaste eben meine Mitarbeiter mehr.“ Dann lacht er. War wohl nur ein Schmäh. Vielleicht. Fest steht: „Man braucht eine dicke Haut, muss mit Menschen umgehen können, auch wenn du im Wellenbecken stehst, bei 40 Grad in der prallen Sonne, dazu das Geschrei von den Kindern und aggressiven Badegästen. Das ist nicht so einfach wie bei ,Baywatch‘.“
Richtung Ausgang entdeckt man den Bereich, den man am Anfang rechts hat liegen lassen: die sechs Kabinenblöcke (A–F), davor die Bäckereien, Imbisse, die Trafik mit den sortierten, aufblasbaren Schwimmfiguren davor – früher gab’s hier sogar mal einen Friseur. Hier sitzen sie dann und futtern noch Freibad-Pommes mit Chicken-Nuggets, trinken ein Gösser-Radler oder einen Verlängerten, schauen einfach in die Gegend, plaudern oder spielen noch eine Partie Schach. Ein wohliges und sediertes Warten auf das Ende des Sommertags. Denn jeden Abend, pünktlich um halb acht, scheppert blechern dasselbe Lied aus allen Lautsprechern auf der Insel: „Badeschluss“ heißt es, fein melancholisch gesungen von der Wiener Kombo „5/8erl in Ehr’n“: „Badeschluss, es ist vorbei, wo der Tag die Nacht begrüßt.“ Jeden Abend. Denn wie sollte ein Tag im Gänsehäufel auch anders enden als mit einem Ritual?