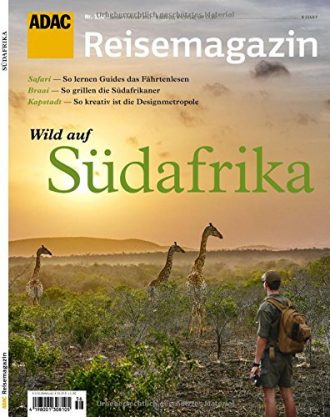Diese Reise ist eine Zeitreise. Ab dem ersten Moment. Ganz hinten, um drei Ecken am quirligen Bahnhof von Pretoria vorbei, liegt die Rovos-Station. Die Hitze lässt die Luft flirren, unter den Schuhen knirschen Kiesel und Schotter. Stille. Im Empfangsraum der Station wartet 100 Jahre alte britische Atmosphäre. Weißes Gebälk mit Deckenventilatoren, schwere Teppiche und Sessel. Das Geschirr trägt das RVR-Logo. Sandwich-Dreiecke und Fruchtspieße stehen auf Etageren bereit, Tee auf der Terrasse, und das Personal ist so freundlich, wie es nur in solch einem britischen Ambiente möglich ist. Alles ist „wonderful“ und „perfect“, und man ist natürlich „more than welcome“. Hier beginnt die Reise mit der Rovos Rail, einem historischen Luxuszug, quer durchs ganze Land, von Pretoria nach Kapstadt.
Für 15 Uhr ist die Abfahrt anberaumt. Die Zeit bis dahin vergeht wie im Flug. Man macht Erinnerungsfotos vor der alten Dampflok oder schaut sich das Museum an, in dem Gert van Vuuren, 70, aufpasst. Ein Kerl wie ein Gleis, stahlhart, dünn und immer geradeaus. Auf seinen Stimmbändern könnte man Parmesan reiben, so sehr raspeln sie seine Worte heraus. Neben seinem Schreibtisch steht ein Bild von der Abschlussklasse 1974 des Esselenpark Railway College, das er stolz jedem zeigt. Gert van Vuuren ist Lokführer, mit jeder Faser seines drahtigen Körpers. Einer wie er geht nicht in Rente, er wechselt das Betätigungsfeld. Und so baute er vor drei Jahren das Museum auf.
Zurück im Haupthaus. Rohan Vos steht am Rednerpult. Er ist der Besitzer von Rovos Rail, die er 1989 gründete, und begrüßt die Teilnehmer dieser zweitägigen Reise nach Kapstadt. Wo Flugbegleiter von Schwimmwesten sprechen, warnt er davor, in den Bahnhöfen die Fenster zu öffnen – wegen der Diebe. Streichhölzer dürfe man nicht aus dem Fenster werfen, die Wüste sei schließlich sehr trocken. Und: „Der Zug ist niemals pünktlich, dafür gibt es kostenfreie Drinks.“ Gelächter. WLAN gebe es keines. Das Gelächter erstickt.
Und dann geht es auch schon los. Der Reihe nach, Waggon für Waggon, werden die Gäste in ihre Suiten gebracht. Dort wartet schon das Gepäck. Und viel vergangener Charme. Das dunkle Holz, die Brokatdecken, die alten Stiche über dem Bett, alles ist aus der Zeit gefallen. Kein Fernseher, kein Radio. Um die Suiten und deren Gäste kümmern sich die Hostessen. Sie wollen nicht Zimmermädchen genannt werden, weil sie so viel mehr tun. In einem Zug dieser Art müsse jeder alles können, irgendwie, sagt Elizabeth Zwane, 28. Sie ist Hostess, früher war sie Stewardess.
Als der Zug losruckelt (er wird selten schneller fahren als 60 Stundenkilometer), ist bereits die meditative Kraft dieser Reise spürbar. Pretorias Vororte ziehen vorbei, und die Pendler an den Bahnstationen blicken irritiert herüber. Man bekommt eben nicht nur Einblick in die Natur dieses Landes, sondern auch in seine Zerrissenheit. Wenn man aus dem Luxus des Zuges hinaus in die Realität blickt – in die eingemauerten Vororte, die Zementfabriken, Townships, auf die matten Arbeiter, die auf ihren Zug warten.
Der Zug ist ein Biotop, ein geschlossenes System – und nicht nur bei Agatha Christie ein wunderbarer Raum für ein Krimi-Kammerspiel. Lyle Ontong, 25, beobachtet das Theater mit seinem Schauspielerlächeln. Er ist Barmann im hinteren Waggon, dem Observation Car. „Hier sitzen die Ehemänner und erzählen mir von ihrer Frau“, sagt er, und sein Blick verrät, dass es selten Schwärmereien sind. Was ihm erzählt wird, bleibt bei ihm. So müssen Barmänner sein. Sein Tag ist lang. Eigentlich soll um Mitternacht geschlossen werden, aber solang noch mindestens zwei Gäste da sind, wird auch bedient. Einmal blieb Ontong bis 5.30 Uhr morgens auf. Da steht er sonst üblicherweise auf.
Am zweiten Tag ist es auch für den Fahrgast ratsam, mal etwas früher aufzustehen und sofort den Rollladen nach unten rattern zu lassen. Vom Bett aus, das den gesamten Raum zwischen Wand und Fenster füllt, wird klar, warum es keinen Fernseher braucht. Erst schweift der Blick, dann die Gedanken, und man fragt sich, warum man das nicht häufiger macht: schweigen und aus dem Fenster schauen. Auf die flache, monotone und unendlich spannende Graslandschaft, den Sonnenaufgang, der die zerfaserten Wolken erst in ein dunkles, dann in immer heller werdendes Rosa färbt. Hinten auf dem Aussichtsdeck sieht man, wie sich das blutorangefarbene Licht des Sonnenaufgangs in den silberglänzenden Schienen spiegelt. Erstaunlich, wie weit das Auge blicken kann, wenn die Landschaft flach und unverbaut ist.
Die Angestellten wuseln längst herum. Lyle Ontong stellt Heizstrahler im letzten Waggon auf, es ist überraschend kalt vormittags im südafrikanischen Winter. „Einer der besten Orte zum Erleben eines Sonnenaufgangs ist die Karoo“, sagt er. Ein Großteil der 1600 Kilometer langen Reise verläuft durch die so charakteristische Halbwüstenlandschaft Karoo. Im Speisewagen gibt es Frühstück: Früchte, Käse, Schinken, Vollkornmuffins, Aprikosenmarmelade. Das Britische bleibt erhalten. Die Fahrt führt am Kamfers Dam vorbei, einem See, in dem Flamingos wie rosa Stecknadeln wirken. Zu weit weg, aber das Ziel des Tages ist ohnehin Kimberley. Wieder ein Stück südafrikanische Geschichte, wieder irgendwie zwiespältig, zerrissen. Hier entstand vor 150 Jahren das damals größte menschengemachte Loch der Welt, auf der erbarmungslosen, mörderischen Jagd nach Diamanten, die hier säckeweise gefunden wurden. In den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts galt Kimberley als reichste Stadt der Welt. Davon ist heute nichts mehr zu sehen.
Vom Zug geht’s in einen Reisebus mit 80er-Jahre-Sitzmuster und einem Fremdenführer, der ebenfalls der Kategorie „Vintage“ angehört. Dafür hat er einen Humor, der in die trockene Staubigkeit der Gegend passt. Frank Dippenaar heißt er, und als alle endlich auf der Aussichtsplattform von Kimberleys Attraktion stehen, sagt er gelangweilt: „Ich erkläre jetzt nicht, warum es ‚Großes Loch‘ heißt.“ Nicht nötig in der Tat, geht es doch 214 Meter in die Tiefe, wo sich in einem Krater grünliches Wasser kräuselt.
Als wir in den Zug zurückkommen, ist das Mittagessen schon fertig. Wie Israel Medupe, 47, und Sarah Serumula, 42, das wieder geschafft haben, ist eines der größten Mysterien dieser Reise. In einer Küche, die nur etwa acht Quadratmeter groß ist, bereiten sie nacheinander Frühstück, Mittag-und Abendessen zu. Einen „scharfen Geist“ benötige er dafür, sagt Medupe, der zuvor schon fünf Jahre für die Rovos-Konkurrenz Blue Train gearbeitet und davor den Vorstand einer großen Bank in Johannesburg bekocht hatte. „Du hast keinen Platz und keine Zeit. Du musst wissen, was du tust“, sagt er, „denn wenn du es nicht weißt, dann bist du ‚fucked up‘.“
Medupe liebt die Herausforderung und auch, dass er so vielseitig sein muss. Alles muss da sein, für alle Religionen, für Veganer, für Allergiker, für Heikle und Verwöhnte. „Da muss man schon beim Einladen der Waren sehr gut aufpassen“, sagt der Koch. Ein Wunder – wie seine ununterbrochen gute Laune. Zwischen Wasserdampf und Geschirrklappern dringen aus der Küche immer wieder Gesang und Gelächter.
Eine Zugfahrt dieser Art verbringen die Gäste zu großen Teilen im Speisewagen. Die Landschaft hat ihren Zauber auch am reich gedeckten Tisch. Das gelbe Gras, die erdbraunen Termitenhügel, die hell-und dunkelgrünen, gedrungenen Bäume und seltsame Farbtupfer wie das Skelett eines gelben Autos. Dazu ausgewählte Weine, präsentiert von Leandra Wilkens, 20, die im Zug die Sommelière gibt. Gelernt hat sie das nicht: Alles, was sie weiß, hat ihr der Rovos-Sommelier beigebracht, und ein kleines Handbuch. Aber das genüge, findet sie. „Ich kann mit Menschen umgehen, und wenn ich ihnen erzähle, dass eine Kokosnuss Wein enthält, dann glauben sie mir.“
Das Besondere der Reise sei der „persönliche Touch“, meint Deputy Manager Lucinda Du Plessis, 28: „Der Zug an sich ist zwar sehr schön, aber es sind die Angestellten, die die Fahrt zum Erlebnis werden lassen.“ Sie balancieren auf der feinen Linie zwischen „Fünf-Sterne-und Spaß-haben-Anspruch“, wie es Du Plessis nennt. Es gelte, die Gäste bei Laune zu halten, sonst drohe der Lagerkoller. „Wir fragen den Ehemann, was die Lieblingsfarbe seiner Frau ist, und wenn seine Antwort stimmt, bekommt er einen Jägermeister.“ Und wenn er falsch liegt? Tja, dann sitzt der Ehemann danach mutmaßlich bei Lyle Ontong und trinkt weit mehr als nur einen Magenbitter.
Ein Lagerkoller droht auch den Angestellten. In einem geschlossenen System wie diesem funktioniert die Arbeit nur im Team, nur wenn jeder mit anpackt, wo er gerade gebraucht wird. Dann räumen auch Barmann Lyle Ontong oder Train Manager Daphne Mabala mal die Teller ab. Dieses gemeinsame Funktionieren ist indes nicht immer einfach. „Weil man sich nicht nach Feierabend ins Auto setzen und nach Hause fahren kann“, wie Lucinda Du Plessis erklärt. Die Angestellten leben zusammen in Viererkabinen mit Stockbetten. Da kracht es dann auch mal. „Vor allem die Catfights nerven mich“, sagt Lucinda Du Plessis und rollt mit den braunen Augen. Sie meint damit die sogenannten Zickenkriege. „Männer streiten, geben sich die Hand und trinken einen, aber Frauen … oooohhh.“
Eine Frau ist Lucinda Du Plessis übergeordnet: Daphne Mabala, 53, Train Manager und somit die Chefin von allen. In den 16 Jahren, die sie mittlerweile für Firmenchef Rohan Vos in Zügen unterwegs ist, hat sie schon allerlei Situationen erlebt. „Ein rollendes Hotel ist etwas Spezielles. Wenn man zwei Tage auf engstem Raum zusammen ist, dann fühlt sich das wie Familie an“, sagt sie. Und eine Familie macht mitunter einiges durch. Seien es Krisen wie damals, als bei Kimberley nach Regenfällen die Gleise weggeschwemmt waren und alle ausquartiert werden mussten. Oder auch Schönes wie bei jenem Gästepaar, das sich im Zug spontan zu einem großen Schritt entschied, sodass Daphne Mabala über Nacht alles organisieren musste: Pfarrer, Brautkleid, Blumen. Am Tag darauf wurde in Matjiesfontein geheiratet.
Hauptsächlich kümmert sich Daphne Mabala aber darum, „dass der Zug fährt“. Ihre Hauptansprechpartner sind deshalb die beiden Herren der Maintenance, der Haustechnik. Meist sind Thabiso Mahlangu, 29, und Jacob Feni, 30, unsichtbar, wenngleich auffällig in ihrer grünen Arbeitshose und mit dem Funkgerät im Anschlag. Unsichtbar und unverzichtbar. Sie sind verantwortlich dafür, dass der Generator läuft, und zwar „smooth and well“, dass immer Wasser im Tank ist, dass die Lampen leuchten und die Klimaanlage funktioniert. Und gerade die macht immer wieder Schwierigkeiten. Aber Thabiso Mahlangu mag das. Nach Abschluss seines Ingenieurstudiums vor gut sechs Jahren fing er gleich bei Rovos Rail an. Er liebt es zu reisen und schätzt die unzähligen Herausforderungen, die dieser Zug bereithält. „Ich lerne ständig was dazu. Gerade für einen Berufsanfänger ist das hervorragend, um sich universell zu bilden, sowohl in Elektronik als auch in Mechanik.“ Mit Feni wechselt er sich alle zwölf Stunden ab, aber auf Stand-by ist er eigentlich immer.
Der Vormittag des zweiten Zugtages beginnt mit einer Wanderung. Etwa eine Stunde geht es über sandige Wege nach Matjiesfontein, zum zweiten wichtigen „Landausflug“ auf der Strecke. Ein seltsamer Ort. Wie eines dieser Städtchen, die in Freizeitparks nachgebildet wurden – irgendwie künstlich, irgendwie sehr verlassen. Es gibt ein Hotel, einen Andenkenladen und mehrere – seltsame – Museen. Eines ist in den Bahnhof eingebaut, das Marie Rawdon Museum. Ein Konzept sucht man vergebens, alles wirkt eher wie Omas Rumpelkammer: eine Apotheke mit Einrichtung, eine Nachttopf-und Kloschüsselsammlung, Porzellangeschirr und Küchengeräte, Puppen, Schreibmaschinen, eine Kapelle, mechanische Spielautomaten, Militaria, eine Wurstschneidemaschine aus dem Jahr 1920. Der Besucher schwankt zwischen Faszination und der Frage „Und warum das nun alles?“.
Nach gut zwei Stunden geht es weiter auf den letzten Teil der Strecke, mit mehreren Tunneln und dem Hex-River-Pass. Landschaftlich der schönste Teil der Reise: rostrote Felsen, Hügel, Weingüter und Unmengen von Fynbos-Sträuchern in immer neuen Kombinationen. Dazu das Sonnenlicht, mal strahlend, mal verdunkelt, mal bereichert durch einen Regenbogen. Wieder verfällt man in diese meditative, dämmernde Ruhe, die nur manchmal gestört wird, wenn der Zug ruckartig bremst.
Mit dauerquietschenden Bremsen schleicht der Zug nach Kapstadt hinein. Fabrikgelände und Townships erinnern wieder daran, dass das Leben kein Luxuszug ist. In Lyle Ontongs Bar läuft Klaviergeklimper von einer CD, es gibt Kuchen und Sandwiches zum Tee. Mattigkeit hat sich breit gemacht. Als der Zug steht, geht es ganz schnell: Das Gepäck wird auf einem Vorplatz bereitgestellt, Taxis und Shuttles kreuzen umher. Daphne Mabala und Crew stehen daneben, verabschieden sich routiniert und nehmen Trinkgelder entgegen.
Am nächsten Tag wird es für sie weitergehen. Nach Hause. „Wir sind ein kleiner Haufen Vagabunden und hüpfen mit unserem Koffer von Zug zu Zug“, sagt Lucinda Du Plessis. Daheim in Pretoria kann auch Elizabeth Zwane wieder ein paar Tage frei machen. Mal wieder richtig ausschlafen. Aber auch das wird schwer werden. „Ich habe immer Probleme einzuschlafen, wenn das Bett so stillsteht.“